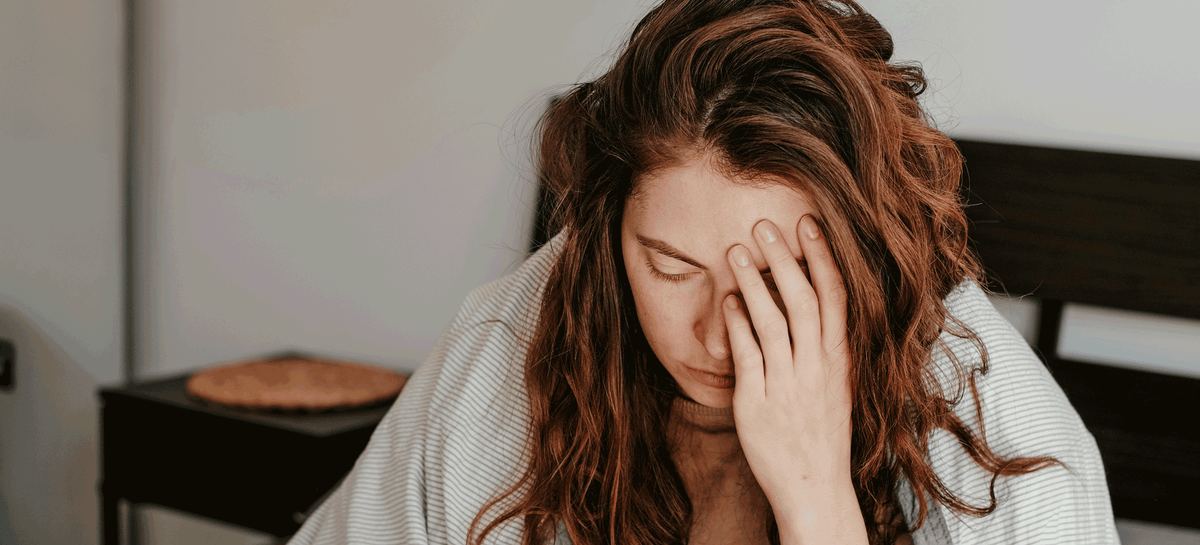
Die stille Pandemie unserer Zeit – Insulinsensitivität
|
Search


Search
|
Weltweit sind Millionen Menschen betroffen – oft ohne es zu wissen. Fachleute sprechen oft metaphorisch von einer „stillen Pandemie“: der Insulinresistenz.
Dabei reagieren die Körperzellen nicht mehr richtig auf das Hormon Insulin, das Glukose aus dem Blut in die Zellen schleusen soll. Bleibt dieser Mechanismus gestört, bleibt Zucker im Blut zurück und wird nicht genutzt. Über Jahre hinweg kann das unbemerkt bleiben – bis ernsthafte Folgen auftreten: Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Fettleber oder sogar ein erhöhtes Krebsrisiko.
Die gute Nachricht: frühzeitig die richtigen Blutwerte checken zu lassen und bei Bedarf den Lebensstil zu ändern, kann den Stoffwechsel nachhaltig wieder ins Gleichgewicht bringen.
Stell dir vor, dein Körper ist wie ein riesiges Hochhaus mit Millionen von Türen. Jede Tür führt in eine Zelle, und damit die Zellen arbeiten können, brauchen sie Energie in Form von Zucker (Glukose). Das Hormon Insulin ist der Schlüssel, der diese Türen öffnet. Normalerweise läuft das wie ein perfekt eingespieltes System: Du isst, dein Blutzuckerspiegel steigt, Insulin öffnet die Türen, und der Zucker gelangt hinein, wo er zu Energie verarbeitet wird. Doch was passiert, wenn die Schlösser klemmen? Wenn die Türen nicht mehr richtig reagieren? Dann kreist der Zucker weiter im Blut, und die Bauchspeicheldrüse produziert immer mehr Insulin. Genau das nennt man Insulinresistenz – eine stille, schleichende Störung, die Millionen Menschen betrifft und als „stille Pandemie unserer Zeit“ gilt.
Dr. Benjamin Bikman von der Brigham University (USA) beschreibt Insulinresistenz als eine der stillen Wurzeln vieler chronischer Erkrankungen. Sie trägt nicht nur dazu bei, dass Krankheiten überhaupt entstehen, sondern kann auch deren Verlauf erheblich verschlimmern. Insulinresistenz ist kein isoliertes Problem, sondern ein gemeinsamer „Boden“, auf dem viele der häufigsten chronischen Krankheiten unserer Zeit gedeihen wie: Typ-2-Diabetes, Metabolisches Syndrom, Arteriosklerose, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, nicht-alkoholische Fettleber sowie Alzheimer und andere Demenzen. All das wird mit Insulinresistenz in Verbindung gebracht. Darüber hinaus deuten Studien (1) darauf hin, dass auch das Risiko für bestimmte Krebsarten steigt.
Studien zeigen außerdem, wie weit verbreitet das Problem ist: In den USA sind schätzungsweise bis zu 85 % aller Erwachsenen betroffen, in Europa mehr als ein Drittel. (2) Auch in Asien und Lateinamerika steigen die Zahlen rasant an. Exakte Zahlen zur Häufigkeit von Insulinresistenz in Österreich gibt es nicht. Als Anhaltspunkt dient jedoch die Prädiabetes-Rate, etwa jede:r Fünfte Erwachsene ist davon betroffen. (3) Trotz dieser weiten Verbreitung ist Insulinresistenz noch immer erstaunlich unbekannt und wird deshalb oft übersehen.
Insulinresistenz könnte einer der wichtigsten Schlüssel zur Vorbeugung und Behandlung zahlreicher Zivilisationskrankheiten sein. Früher galt sie vor allem als Begleiterscheinung eines ungesunden Lebensstils – geprägt von zu viel Essen und zu wenig Bewegung. Ein Problem also, das man eher bei älteren Menschen und in wohlhabenden Gesellschaften vermutete. Doch dieses Bild hat sich deutlich verändert: Heute sind sogar Kinder betroffen, und in vielen Ländern mit niedrigem Einkommen gibt es inzwischen mehr Erkrankte als in den klassischen Industrienationen. (4) Zu den Risikogruppen gehören Menschen mit Übergewicht, kardiovaskulären Erkrankungen, viel Bauchfett und Leberverfettung sowie Frauen, die in den Wechseljahren deutlich an Gewicht zugenommen haben.
Bevor wir tiefer eintauchen, schauen wir uns Insulin genauer an:
spielt eine zentrale Rolle bei der Stabilisierung des Blutzuckerspiegels
Es ist ein Peptidhormon (Botenstoff), das in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird
Es wird nach dem Essen ins Blut ausgeschüttet, sobald der Blutzuckerspiegel steigt
Es wirkt wie ein Transporteur: Insulin signalisiert der Zelle, Transporttüren zu öffnen, durch die Glukose aus dem Blut in die Zelle gelangt.
Dadurch können Zellen, egal ob Muskel, Leber, Herz, Gehirn oder Fettzellen, Glukose aufnehmen und verwerten.
Aber Insulin ist mehr als nur ein „Blutzuckerschlüssel“ – Es ist ein anaboles Hormon, das:
in der Leber den Aufbau von Fett fördert
in den Muskeln die Bildung neuer Eiweißmoleküle anregt (wichtig für den strukturellen Aufbau)
steuert wie die Zellen Energie verwerten, wie sie wachsen, Hormone bilden und sogar wie sie weiterleben oder sterben
Wachstums- & Aufbauvorgänge im gesamten Körper steuert
Man kann sich Insulin wie einen Dirigenten vorstellen, der das Zusammenspiel von Energie, Wachstum und Balance leitet.
Am Anfang reagieren die Zellen noch normal. Doch mit der Zeit – durch falsche Ernährung, Bewegungsmangel, Stress und genetische Faktoren – verlieren sie ihre Sensibilität. Bei einer Insulinresistenz reagieren die Körperzellen nurmehr abgeschwächt auf das Hormon Insulin.
Die Zellen werden unempfindlicher
Insulin klopft an, aber die Zellen reagieren nicht mehr so gut.
Die Bauchspeicheldrüse kompensiert
Sie produziert immer mehr Insulin, um den Zucker doch noch hineinzuschleusen → man spricht von Hyperinsulinämie.
Der Blutzucker bleibt (noch) normal
Oft bleibt der Blutzuckerspiegel lange im Normbereich, sodass Betroffene nichts merken.
Die Bauchspeicheldrüse erschöpft sich
Nach Jahren kann sie nicht mehr genug Insulin produzieren. Dann steigt der Blutzucker dauerhaft an.
Die Krankheit macht sich bemerkbar
Spätestens jetzt entwickelt sich Typ-2-Diabetes, oft begleitet von weiteren Erkrankungen.
Es ist also ein schleichender Prozess. Ein erhöhter Insulinspiegel im Blut kann schon bis zu 20 Jahre vor einem Typ-2-Diabetes auf eine Insulinresistenz hinweisen. Dennoch wird dieser Wert kaum routinemäßig gemessen. Ein Diabetes wird meist erst dann diagnostiziert, wenn der Blutzucker dauerhaft über 126 mg/dl liegt – zu diesem Zeitpunkt besteht die Insulinresistenz aber oft schon lange. Insulinresistenz begünstigt nicht nur Übergewicht und Fettleber, sondern kann auch bei normalgewichtigen Menschen auftreten, weshalb sie so häufig unbemerkt bleibt. Darüber hinaus ist sie mitverantwortlich für erhöhte Blutfettwerte, Bluthochdruck, Störungen der Eierstockfunktion, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Alzheimer sowie ein erhöhtes Risiko für Brust- und Prostatakrebs.
Umso wichtiger ist es, Insulinresistenz rechtzeitig zu erkennen: Bluttests in Kombination mit gezielten Lebensstiländerungen können helfen, viele dieser schwerwiegenden Folgen zu verhindern.
Insulinresistenz entwickelt sich nicht durch eine einzelne Ursache, sondern durch ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren, die sowohl den Stoffwechsel als auch das hormonelle Gleichgewicht im Körper beeinflussen.
Bauchfett ist kein stiller Speicher, sondern ein hormonell aktives Gewebe.
Es schüttet Entzündungsstoffe aus, die die Insulinwirkung hemmen.
Muskeln sind die größten „Zuckerverwerter“. Wer sie nicht regelmäßig nutzt, verliert ihre Fähigkeit, Insulin aufzunehmen.
Zucker, Weißmehl, raffinierte Kohlenhydrate und Transfette verschärfen das Problem. Dauerhafte Überernährung überfordert die Stoffwechselwege.
Stresshormone wie Cortisol treiben den Blutzuckerspiegel hoch.
Gleichzeitig blockieren sie die Insulinwirkung.
Schon wenige Nächte zu wenig Schlaf können die Insulinempfindlichkeit deutlich verschlechtern.
Studien zeigen: Wenn ein Elternteil insulinresistent ist, haben die Kinder ein deutlich erhöhtes Risiko.
Überraschend: Auch zu wenig Salz kann eine Rolle spielen. Studien zeigen, dass salzarme Kost die Insulinresistenz erhöhen kann. (5)
Rauchen, Alkohol, bestimmte Medikamente (z. B. Kortison), hormonelle Erkrankungen, chronische Entzündungen.
Studien zeigen, dass nicht nur der eigene Lebensstil, sondern auch genetische Faktoren eine große Rolle bei der Entwicklung von Insulinresistenz spielen. Eine US-amerikanische Untersuchung (6) mit mehr als 250 Kindern und ihren Eltern ergab: Rund ein Viertel der Mütter und ein Drittel der Väter wiesen bereits Anzeichen einer Insulinresistenz auf – vor allem ungünstige Blutwerte wie ein zu niedriges HDL-Cholesterin.
Die Kinder dieser Eltern waren deutlich häufiger übergewichtig und zeigten ebenfalls erste Störungen in der Insulinverwertung, auch wenn sie noch nicht alle Kriterien für ein sogenanntes metabolisches Syndrom erfüllten. Besonders spannend ist, das nicht das Übergewicht der Eltern, sondern ihre Insulinresistenz ausschlaggebend war für den Stoffwechsel der Kinder. Das verdeutlicht, dass genetische Veranlagung in Kombination mit familiären Faktoren wie Ernährung und Bewegung stärker wirkt, als man lange dachte.
Insulinresistenz entwickelt sich oft schleichend und bleibt lange unentdeckt, da die Blutzuckerwerte zunächst noch im Normalbereich liegen. Trotzdem gibt es Anzeichen, die aufmerksam machen sollten: Viele Betroffene fühlen sich nach kohlenhydratreichen Mahlzeiten ungewöhnlich müde, leiden unter dauerhafter Erschöpfung oder nehmen trotz gesunder Ernährung kaum ab. Auch Heißhunger auf Süßes, Wassereinlagerungen, erhöhte Triglyceride, Bauchfett, Bluthochdruck oder Migräne können Hinweise sein.
Besonders gefährdet davon betroffen zu sein sind Frauen mit PCOS (polyzystisches Ovarialsyndrom) sowie Männer mit erektiler Dysfunktion. Weitere mögliche Signale sind Zittern, Nervosität oder Angstzustände – ähnlich wie bei Unterzuckerung, jedoch bei normalen Blutzuckerwerten. Auch eine familiäre Vorbelastung für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht das Risiko deutlich.
Damit Insulinresistenz zuverlässig erkannt wird, braucht es eine genaue ärztliche Abklärung – etwa beim Hausarzt, Diabetologen oder Endokrinologen. Entscheidend sind Laboruntersuchungen, die je nach Verfahren in direkte und indirekte Methoden eingeteilt werden.
messen Glukose- oder Insulinwerte in Echtzeit
dieser gilt als Goldstandard und misst sehr präzise die Insulinsensitivität – allerdings ist er aufwendig und wird in der Praxis selten eingesetzt
nutzen rechnerische Modelle, um die Werte zu einem späteren Zeitpunkt auszuwerten
Dabei wird der Blutzucker nach dem Trinken einer Zuckerlösung über mehrere Stunden gemessen. In Kombination mit einer gleichzeitigen Bestimmung der Insulinwerte kann so sichtbar werden, wie gut der Körper Zucker verarbeitet.
Eine direkte Laboranalyse zeigt, wie viel Insulin im Plasma vorhanden ist. Abweichungen vom Normalbereich können auf eine gestörte Insulinwirkung hinweisen.
Besonders verbreitet ist dieser Index, der aus nüchtern gemessenen Glukose- und Insulinwerten berechnet wird (mindestens 8 Stunden ohne Nahrung).
Ein HOMA-Index unter 2 gilt als normal.
Werte über 2 deuten auf eine Insulinresistenz hin.
Werte über 2,5 machen sie sehr wahrscheinlich.
Auch der Nüchtern-Insulinwert kann wertvolle Hinweise auf eine Insulinresistenz liefern. Bei Erwachsenen liegen die Normalwerte in der Regel zwischen 3 und 25 µU/mL, je nach Labor mit leichten Abweichungen. Optimal ist jedoch ein Wert von unter 6 µU/mL.
Studien zeigen (7): Wer bei nüchternem Zustand einen Wert von 8 µU/mL oder höher hat, besitzt bereits ein doppelt so hohes Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken, wie jemand mit einem Wert um 5 µU/mL. Ein niedriger Insulinspiegel gilt daher als wichtiger Schlüssel für langfristige Stoffwechselgesundheit.
Wichtig: Auch wenn der HOMA-Index im Normalbereich liegt, kann ein oraler Glukosetoleranztest (oGTT) sinnvoll sein – besonders, wenn Symptome wie anhaltende Müdigkeit, Heißhunger oder Bauchfett auftreten. Denn bei manchen Menschen wird eine Insulinresistenz erst dann sichtbar, wenn der Körper mit einer Zuckerbelastung „herausgefordert“ wird.
Bei diesem Test trinkt die Testperson eine süße Lösung mit 75 g Glukose, das entspricht etwa einer kräftigen Portion Zuckerwasser. Danach wird nach 1-2 Stunden gemessen, wie stark Blutzucker und Insulin im Körper ansteigen. So kann man erkennen, wie gut der Stoffwechsel auf die Zuckerbelastung reagiert. In einem gesunden System steigt das Insulin zügig an, bringt den Zucker aus dem Blut in die Zellen und fällt danach gleichmäßig wieder ab. Bei einer beginnenden Insulinresistenz läuft dieser Prozess jedoch verzögert ab – der Körper schüttet immer größere Mengen Insulin aus, weil die Zellen nicht mehr richtig darauf ansprechen. Das ist ein frühes Warnsignal dafür, dass das sensible Gleichgewicht im Zuckerstoffwechsel aus dem Takt geraten ist.
Symptome wie Hitzewallungen und nächtliches Schwitzen gelten als typische Begleiterscheinungen der Wechseljahre. Doch laut aktuellen Erkenntnissen könnten sie mehr über die Stoffwechsellage aussagen, als bisher vermutet.
Eine große US-amerikanische Langzeitstudie (8) mit Frauen um die 46 Jahre untersuchte den Zusammenhang zwischen diesen Beschwerden und dem Vorliegen einer Insulinresistenz, also einer gestörten Insulinverwertung.
Das Ergebnis war bemerkenswert. Frauen, die häufiger unter Hitzewallungen oder Nachtschweiß litten, zeigten deutlichere Anzeichen einer gestörten Insulinverarbeitung – unabhängig von Alter, Gewicht, Hormonstatus oder Lebensstil. Besonders ausgeprägt war der Zusammenhang bei jenen, die an mindestens sechs Tagen innerhalb von zwei Wochen von diesen Symptomen betroffen waren. Auch eine leichte Erhöhung des Nüchternblutzuckers wurde in dieser Gruppe häufiger beobachtet.
Die Forscherinnen und Forscher schließen daraus, dass klimakterische Beschwerden ein früher Hinweis auf eine beginnende Insulinresistenz sein könnten und damit auch auf ein erhöhtes Risiko für spätere Stoffwechsel- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Eine gezielte Prävention sollte daher bereits in der Lebensmitte beginnen. Lange bevor sich ernsthafte Erkrankungen entwickeln.
Die gute Nachricht ist: Eine Insulinresistenz ist in vielen Fällen umkehrbar. Zahlreiche Studien zeigen, dass gezielte Veränderungen im Lebensstil die Insulinsensitivität deutlich verbessern können. Besonders effektiv ist dabei eine Kombination aus regelmäßiger Bewegung, bewusster Ernährung und Stressreduktion.
Schon 150 Minuten moderate Bewegung pro Woche: Zügiges Gehen oder leichtes Krafttraining fördern die Aufnahme von Glukose in die Muskelzellen. Besonders wirkungsvoll ist eine Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining, da sie sowohl den Zuckerstoffwechsel als auch die Muskelkraft stärkt.
Intervallfasten und Ernährung mit niedrigem glykämischen Index: Reich an Gemüse, Hülsenfrüchten, hochwertigen Fetten und moderaten Mengen komplexer Kohlenhydrate unterstützen den Körper dabei, die Insulinantwort zu normalisieren.
Erholsamer Schlaf: Schon wenige Tage Schlafmangel können die Insulinempfindlichkeit messbar verschlechtern. Auch ein gesundes Gewichtsmanagement spielt eine entscheidende Rolle, da überschüssiges Körperfett – insbesondere im Bauchraum – die Insulinresistenz weiter verstärken kann.
Ein gesunder Lebensstil kann also enorm viel bewirken – doch manchmal reicht er allein nicht aus, um den Stoffwechsel vollständig ins Gleichgewicht zu bringen. Wenn etwa die Blutzucker- oder Insulinwerte stark erhöht sind (z. B. beim oralen Glukosetoleranztest) oder sich trotz Anpassungen keine Besserung zeigt, kann eine ergänzende medikamentöse Behandlung notwendig sein. Welche Medikamente dabei zum Einsatz kommen, entscheidet der behandelnde Arzt individuell anhand der Gesundheitsgeschichte und Laborwerte.
Trotzdem gilt: Wer frühzeitig mit Veränderungen im Lebensstil beginnt, bewusst auf Ernährung, Bewegung und Schlaf achtet und Stress reduziert, hat sehr gute Chancen, eine Insulinresistenz ohne oder mit nur minimaler medikamentöser Unterstützung zu überwinden – und damit die Basis für langfristiges Wohlbefinden und Gesundheit zu legen.
Verfasserin: Sabine Mayrhofer
Inspiriert von einem Artikel aus der Zeitschrift Natur & Heilen, Ausgabe 9/2025
Haftungsausschluss/Hinweis des Herausgebers: Die in allen Veröffentlichungen enthaltenen Aussagen, Meinungen und Daten sind ausschließlich die des/der einzelnen Autors/Autoren und Beitragenden und nicht die von MDPI und/oder dem/den Herausgeber(n). MDPI und/oder der/die Herausgeber lehnen die Verantwortung für Personen- oder Sachschäden ab, die durch im Inhalt erwähnte Ideen, Methoden, Anweisungen oder Produkte entstehen.
Verweise:
(2) Araujo et al., 2019
(3) Ilias Migdalis et al., 2025
(4) Chiarelli et al., 2008, Roglic et al., 2016
(7) Johnson et al., 2010





